Vertiefung: Shadow of the Colossus
- Jörg Luibl

- 13. Feb.
- 10 Min. Lesezeit
Ich springe aus vollem Galopp von einem Pferd, um mich am Flügel eines riesigen Drachen festzuhalten, der so über Berg und Tal hinweg rast, dass sie unter mir in sandgrauen Konturen verschwimmen. Während ich wie eine Spielzeugpuppe vom Wind geschüttelt werde, geht er in einen Gleitflug über. Ich kann mich hinauf ziehen, auf den mächtigen Rücken springen und über die schuppige Lederhaut taumeln, an knochigen Wirbeln vorbei, die wie Bäume vor mir aufragen.
In weiter Ferne, ganz hinten am Schweif, erkenne ich das blaue Glimmen, das die verwundbare Stelle dieses Kolosses zeigt. Aber plötzlich schlägt er mit den Flügeln, ich stürze, halte mich in letzter Sekunde an einem Fellbüschel fest, hunderte Meter freien Fall unter mir. Wird die Ausdauer reichen? Werde ich dem Ziel im nächsten Gleitflug näher kommen, um schließlich mein Schwert mit aller Gewalt in dieses Wesen zu stoßen, während schwarzes Blut in einer Fontäne heraus spritzt und es vor Schmerz aufschreit?
Nur durch die Vernichtung aller 16 Kolosse hoffe ich als Held namens Wander die verstorbene Geliebte Mono wieder lebendig machen zu können. Laut Story bin ich in einem verbotenen Land unterwegs, überschreite dabei aber längst mehr als eine territoriale oder religiöse Grenze. Denn ich töte etwas Uraltes und Schönes, ich kappe eine Verbindung und breche Tabus, um etwas Verstorbenes und Schönes zu beleben. Vielleicht verspüre ich deshalb im Moment des grausam inszenierten Todes nicht nur diese Scham, sondern diese ungewöhnliche Trauer.
Ich wollte eigentlich auf einen szenischen Einstieg verzichten. Aber Formulierungen wie „situative Spannung“ oder „revolutionäre Bosskämpfe“ werden diesem außergewöhnlichen Action-Adventure nicht gerecht, in dem sich jede Kleinigkeit, vom Haar bis zur Pupille, vom Licht bis zur Musik in ein digitales Erlebnis höchster künstlerischer Ausdruckskraft und spielerischer Intensität einfügt. Denn das, was am 18. Oktober 2005 aus dem Schatten der PS2 trat, war tatsächlich etwas nicht Erspieltes, etwas nahezu Unvergleichbares, das selbst erfahrene Spieler und Journalisten weltweit in Staunen versetzte.
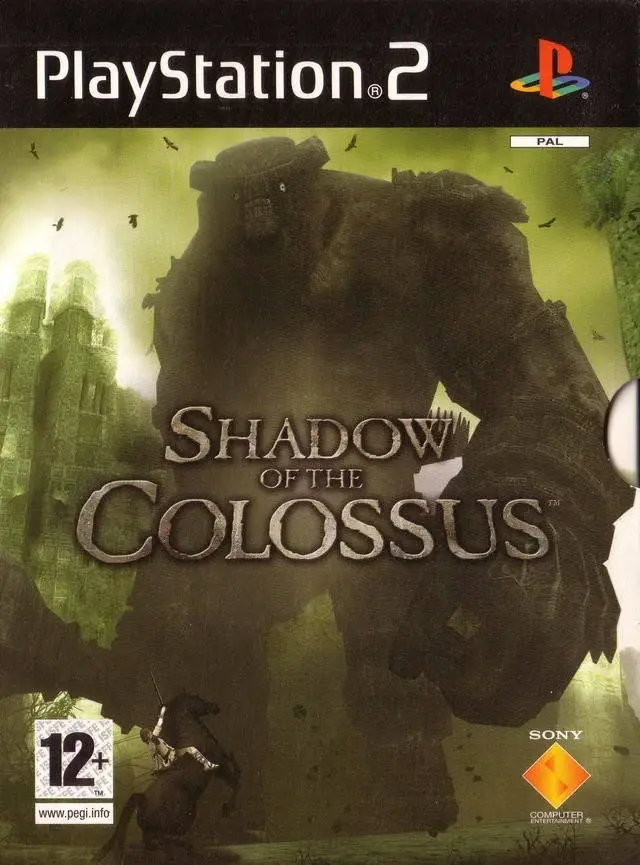
Und zwar auf andere Art als in der üblichen Euphorie angesichts eines weiteren sehr guten Spiels, von denen jedes Jahr dutzende ausgezeichnet werden. Alle Videospiele stehen natürlich in einer Tradition der gegenseitigen Beeinflussung mit schier unendlichen Wechselwirkungen, die weit über digitale Impulse hinaus bis in die Kulturgeschichte zurückreichen. Und in der Regel prägen bekannte Muster sowie Motive die Unterhaltung, vor allem im Bereich des Action-Adventures. Sprich: Man wird von einem The Legend of Zelda und all seinen Nachfahren eher auf vertraute Art fasziniert als auf wirklich neue Art erstaunt.
Wenn Spiele sowohl in ihrer Struktur als auch ihrem Design experimentell abweichen, dann meist in Genres wie der Geschicklichkeit, der Puzzles oder der Simulation, in denen es nicht in erster Linie um die Harmonie eines klassischen Abenteuers, um eine Geschichte samt Erkundung und Kampf geht. Aber das, was Team Ico unter Leitung von Fumito Ueda und Japan Studio für Sony Computer Entertainment inszenierten, sprengte die Grenzen konventioneller Abenteuer. Nicht wie so oft Anfang der 2000er Jahre aufgrund einzelner Aspekte wie der Grafik oder der Action, dem Leveldesign oder der offenen Welt, sondern aufgrund eines außergewöhnlichen Erlebnisses, das einer künstlerischen Vision in aller Konsequenz folgte.
Ich war damals 32 Jahre alt, seit fünf Jahren Redakteur und einfach erstaunt. Ich hatte herausragende Spiele wie Shenmue, Baldur’s Gate 2, Metroid Prime 2, Planescape Torment, Silent Hill 2 oder Resident Evil 4 erlebt, aber noch nie diese Mischung aus Gänsehaut und Ehrfurcht, aus emotionaler Anbindung und regelrechter Verblüffung. Als Spieler schrumpfte ich im Angesicht der Kolosse im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich staunte wieder wie ein Kind, spielte nicht nur mit offenem Mund, sondern machte mir Gedanken über Leben und Tod, die Natur und den Menschen.

Ich bildete mir sogar ein, recht kritisch und immun gegenüber den üblichen Lobeshymnen zu sein, aber schon nach drei von sechzehn Kolossen kritzelte ich in mein kariertes DinA6-Heft nur noch ein Wort: Wow! Ich schrieb danach nichts mehr auf, weil ich gar nicht mehr auf der Couch war. Wie konnte dieses Spiel so wirken? Es lag natürlich nicht alleine an der bemerkenswerten Tatsache, dass all das auf einer betagten Konsole ablief, die schon ein Jahr später von der PS3 abgelöst werden sollte. Zwar wurde das in der Bildrate und kleinen Defiziten spürbar, aber hier wurde ja nicht nur die Hardware ausgereizt, was Beleuchtung (HDR wurde quasi erstmals simuliert), Texturen, KI und Animationen anging - all das fast ohne Ladezeiten in offener Welt. Viel erstaunlicher war, dass hier erstmals Bosskämpfe als bewegte Levels im Level inszeniert wurden. Das war eine große technische Pionierleistung.
Sie inspirierte viele Spieldesigner, so dass man ähnliche Szenen später in God of War II & III (2007 & 2010), in Titan Souls (2015), in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), in Death's Gambit (2018), Praey for the Gods (2019), in Elden Ring (2022) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) erleben konnte. Aber daraus entwickelte sich kein neues Subgenre wie etwa Colossus-likes im Stile von Souls-likes. Abgesehen davon, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht mit einem Dark Souls (2011) vergleichbar war, ließ sich dieses Abenteuer nicht so leicht nachahmen, weil es als Videospiel einzigartiger komponiert war.
Denn es ging um mehr als bewegte Levels im Level. Shadow of the Colossus war in mehrfacher Hinsicht einzigartig: technisch, spielerisch, atmosphärisch und im weitesten Sinne philosophisch. Das hat sehr viel damit zu tun, dass die Vision dahinter von einem Künstler namens Fumito Ueda stammt. Inspiriert von The Legend of Zelda, den Monsterfilmen seiner Kindheit und dem speziellen Sound von Silent Hill, dessen melancholische Atmosphäre ihn beeindruckte, wollte der eher medienscheue und zurückhaltende Spieldesigner ein Abenteuer über Tod und Trauer inszenieren, mit einem schweigsamen Helden und einer Welt, die er selbst gerne erkunden würde.

Im Gegensatz zu klassischen Märchen sind Gut und Böse hier nicht so klar verteilt. Aber was ich damals nicht sofort sah, waren die altorientalischen sowie biblischen Bezüge, die sich u.a. im sprachlichen Kauderwelsch sowie in der unsichtbaren Gestalt des Dormin zeigen, der dem Helden in seinem Tempel das verführerische Angebot der Wiederbelebung macht. Sein Name ist ein Anagramm von Nimrod, einer mythischen Figur, der man den Bau des Turmes von Babel nachsagt. Man kann das architektonische Zentrum des Abenteuers damit in Verbindung bringen, zu dem der Held nach jedem erlegten Koloss zurückkehrt und das auch im Finale eine tragende Rolle spielt. Aber das waren nur einige Inspirationen neben vielen anderen, zumal es Ueda in Shadow of the Colossus nicht um Religion, sondern um Abenteuer in einer Welt mit suggerierter historischer Tiefe ging.
Die Kraft seiner stillen Fantasy, in der sich das Märchenhafte und Brutalistische, das Traurige und Heroische treffen, war schon in Ico (2001) spürbar - das immerhin einen gewissen Hidetaka Miyazaki, den Schöpfer der Soulsreihe, so begeisterte, dass er selbst Videospiele machen wollte. Zwar war dieses Action-Adventure mit dem kleinen Jungen und dem Mädchen Yorda, in dem man zusammen gegen Schatten kämpfte und sich durch Burganlagen rätselte, ein Liebling der Kritiker, aber es verkaufte sich nicht gut.
Team Ico und Sony einigten sich Anfang der 2000er Jahre auf einen Nachfolger mit mehr Action, der eigentlich als Multiplayer-Spiel geplant war. Aber es gehört aus spielhistorischer Sicht zu den wunderbaren Nebeneffekten der begrenzten Ressourcen, dass Ueda dem Publisher (ähnlich wie kürzlich Naughty Dog nach der Einstellung von The Last of Us Online) klar machen konnte, dass sein Team für Online-Service viel zu klein ist. Und das, was er Sony als alternatives Konzept für Solisten demonstrierte, lieferte ihm einen Freifahrtschein.
Also konnte er sich über drei Jahre mit etwa 40 Entwicklern auf Shadow of the Colossus konzentrieren. Es sollte offiziell kein Nachfolger von Ico werden, doch nicht nur aus stilistischer Sicht knüpfte man an die Kulissen und Kreaturen dieser monumentalen Fantasywelt an. Allerdings designte man die Landschaften und vor allem die Wesen auf einem ganz anderen Niveau, was ihre Details und Animationen, ihren Ausdruck und ihr Verhalten betraf, das sich je nach Aktion des Helden änderte, so dass die Wesen nicht einfach wie übergroße Monster mit Kletter- und Greifoptionen, sondern wie Charaktere mit glaubwürdigen Reaktionen wirken konnten.

Wenn aus einem scheinbar tiefen See plötzlich eine ebenso stark behaarte wie bemooste Gestalt auftauchte, die Wale zum Frühstück verspeisen würde und der das Nass bei voll aufgerichteter Drohpose nur noch bis ans Knie reicht, raste der Puls. Dieses Spiel definierte den Begriff Boss völlig neu, denn die urtümlichen Titanen hatten nicht nur diese visuelle Präsenz, sondern sie agierten unberechenbar. Egal ob zwei- oder vierbeinig, mit Schwertern oder Hörnern bewaffnet, schwimmend oder fliegend - jeder hatte seine eigenen Stärken und Schwächen, jeder musste auf eine bestimmte Art besiegt werden, indem man clever vorging. Mal wirft die Wucht eines Geysirs die Riesen um, mal muss man einstürzende Säulen nutzen, sie gezielt in Abgründe locken oder auf dem Rücken des Pferdes reitend den idealen Absprungmoment finden.
Diese Leidenschaft für Kreaturen ist ein Teil von Uedas Biografie: Schon im Kindergarten gewann er einen Zeichenwettbewerb mit einer übergroßen Schildkröte, die den Rahmen ihres Blattes zu sprengen drohte. Nachdem er erfolgreich Kunst studierte und mit 23 Jahren einen mit 1000 Dollar dotierten Nachwuchspreis von Sony gewann, installierte er einen Käfig in einem Shopping-Center; mit Kratzspuren im Sand und einem Schild samt der Warnung, dass eine gefährliche Katze darin sei. Sobald sich jemand neugierig näherte und den Kopf darüber beugte, betätigte er einen Knopf, der Sand wurde plötzlich aufgewühlt und der Besucher erschreckte sich. Die Freude über diese Reaktionen dürfte jener entsprechen, die er als Designer empfindet, wenn seine Wesen etwas in ihm und im Spieler auslösen.

Zwar setzte die Akribie, mit der Ueda jedem ihrer Merkmale seine volle Aufmerksamkeit schenkte, die verantwortlichen Designer stark unter Druck. Und als er sein Team im künstlerischen Bereich vergrößern durfte, wählte er aus über 500 Bewerbern nur zehn, von denen er nicht mal alle für gut genug hielt. Aber es war auch diese Besessenheit des Künstlers, die letztlich erstaunliche Kreaturen hervorbrachte, die es so weder in einem Videospiel noch in einem historischen Bestiarium gegeben hat. Im Einstieg nannte ich den fliegenden Koloss einen Drachen, obwohl er sich einer klassischen Definition entzieht und nicht mit jenen Kreaturen aus Mittelerde oder Dungeons & Dragons vergleichbar ist.
Er wirkte urtümlicher, archaischer und fügt sich damit wie nahezu alles von der Echse im Wüstensand bis zum Gipfel zwischen den Wolken in ein Spiel ein, das wie ein Monument aus uralter Zeit anmutete. Dazu trug eine eindrucksvoll designte Landschaft bei, in der verwitterte Ruinen und gigantische Brücken mit Canyons und Bergen seit Jahrtausenden verwachsen scheinen. Und obwohl seit über zwei Jahrzehnten zig Monster in XXL die Bildschirme füllten, war man ihnen noch nie so unheimlich nah. Denn man erkletterte und besiegte sie nicht nur wie einen Feind, sondern spürte im Akt ihrer Vernichtung diese seltsame Trauer, weil man sie als Wesen wahrnahm.
Dazu gehörte auch das Pferd Agro, das ungewöhnlich lebendig wirkte und alles an Vierbeinern in den Schatten stellte, was es bis dahin genreübergreifend auf PC und Konsole gab. Nicht nur, weil es so realistisch aussah oder alle Gangarten beherrschte, sondern weil es sich so glaubwürdig verhielt: Es scheute vor Abgründen, genehmigte sich eigenständige Ausritte, widersetzte sich bei Gefahr und steuerte sich damit nicht so wie ein Auto, sondern wie ein Lebewesen mit eigenem Willen. Auch dieses komplexe Verhalten ist Ueda zu verdanken, der seine Erfahrungen als Reiter einfließen ließ.

Seine Akribie und sein ausgeprägter Sinn für animierten Realismus, vom Muskel bewegten Fell bis zum Schatten von Tränenspuren sollte seinen Höhepunkt in The Last Guardian (2016) in Form des Wesens Trico erreichen. Seine drei Spiele zeigen trotz ihrer Widersprüche, immerhin tötet man mal Kolosse und ist später mit einem als Freund unterwegs, eine künstlerische und spielerische Entwicklung. Mit Ico und Yorda, Wander und Agro, dem Jungen und Trico überschreitet man immer wieder erstaunliche Grenzen, nicht nur innerhalb einer abstrakt zusammen hängenden Fantasywelt, sondern auch als Spieler. Jedes dieser drei Abenteuer inszenierte zu seiner Zeit etwas Einzigartiges, ohne spielerisch direkt anzuknüpfen - dieses nur entfernt Vertraute ist der Unterschied zu der klaren Linie zwischen Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne.
Zum entfernt Vertrauten gehört auch die Reduzierung auf das Wesentliche, die Shadow of the Colossus so wohltuend vom Mainstream unterschied. Es verzichtete weitgehend auf Texte, Dialoge oder andere Formen des direkten Storytellings. Es verzichtete auf Erfahrungspunkte, Aufstiege und Fähigkeiten. Es verzichtete auf zusätzliche Rüstungen oder Waffen. Während man die offene Fantasywelt im Sattel von Agro oder zu Fuß durchstreift, hackt man sich nicht wie so oft durch Horden an Gegnern, sammelt man nicht wie so oft endlos Beute, um im Level aufzusteigen, sondern sucht in aller Ruhe und Weite die verborgenen Orte der Kolosse.
Mal ist man in Ebenen unterwegs, in gleißender Helligkeit, kurze Zeit später in der schattigen Kühle des Waldes. Dort hört man einen Wasserfall rauschen und muss sich erst an die Dunkelheit zwischen den Bäumen gewöhnen, die nur von vereinzelten Lichtschächten durchbrochen wird. Man trifft in jeder Region auf andere Tiere: Möwen, Fledermäuse oder Schildkröten, die sogar den Kopf einziehen. Ab und zu wird man von einem Falken im eleganten Gleitflug begleitet. Das sind nach den akrobatischen Drahtseilakten auf den Kolossen fast schon majestätische Momente.

Mir hat diese Ruhe vor dem nächsten Sturm sehr imponiert, weil der Spielrhythmus davon profitiert. Er erinnert an die symphonischen Dichtungen des finnischen Komponisten Jean Sibelius: Lange Phasen der Stille, in denen man nur den Wind rauschen oder wehmütige Akkorde hört, wechseln sich mit brachialen Paukenschlägen ab, die die Erde erzittern lassen.
Zwar kann man seine Ausdauer ein wenig mit erlegten Echsen und seine Gesundheit mit Früchten permanent steigern, aber man besitzt nur ein legendäres Schwert und einen Bogen. Und trotzdem entwickeln sich der Held und die Geschichte auf dieser Reise, denn mit jedem besiegten Koloss verändert sich sein Äußeres ein klein wenig, er wird blasser und wirkt kränklicher. Neben diesem körperlichen Verfall muss er im letzten Drittel des Abenteuers auch mit den Konsequenzen seines unerlaubten Eindringens leben, denn er wird von einer Gruppe gejagt. Spätestens hier wird die Ahnung zur Gewissheit, dass er für die Wiederbelebung seiner Liebe einen hohen Preis zahlen muss.
Shadow of the Colossus entzog sich damit gängigen Schubladen und Kategorisierungen, es flog weit über die Level- und Loot-Tretmühlen sowie den grellen Kitsch der Videospiel-Kulissen hinaus und erschuf damit eine ganz eigene Fantasy-Ästhetik.

Diese ragte gerade im Kontext einer Zeit heraus, in der es abseits des von Shootern und Action geprägten Mainstreams noch nicht diese Fülle an alternativen Spielen oder gar eine Independent-Welle gab, die erst einige Jahre später von Braid (2008), Minecraft (2009) & Co angestoßen wurde und die heutzutage wesentlich vielfältigere digitale Welten und visuelle Stile birgt. Trotzdem kenne ich fast zwanzig Jahre später kein vergleichbares Spiel. Ich müsste hinsichtlich einer ähnlichen Wirkung die Phantastik heranziehen, um Fantasyromane wie Elric oder Zeichentrickfilme wie Das letzte Einhorn oder Prinzessin Mononoke nennen. Ähnlich wie diese Meisterwerke hält Shadow of the Colossus selbst dem größten Kritiker stand: der Zeit.
Ich scheue mich bis heute, den Begriff Kunstwerk für Videospiele zu gebrauchen. Zum einen weil ich nicht genau definieren kann, was das ist. Und zum anderen, weil ich die inflationäre Anwendung für alles, was da auf dem Bildschirm abläuft, zwar kulturpolitisch verstehen kann, aber spielkulturell und ästhetisch eher als Gleichmacherei wirklich herausragenden Spieldesigns oder gar genialer Schöpfungen verstehe. Und als solche empfinde ich Shadow of the Colossus.
Versionen: Shadow of the Colossus (PS2), 2005, Team Ico The Ico & Shadow of the Colossus Collection (PS3), 2011, Remaster, Bluepoint Games
Shadow of the Colossus (PS4), 2018, Remake, Bluepoint Games
PS: Damit die Diskussion an einer Stelle gebündelt wird, kann man nicht hier, sondern nur im Forum unter Kommentare zu Berichten kommentieren.










Comments